Seit geraumer Zeit lande ich mit meinen Gesprächspartnern immer wieder an einem Punkt: Warum kommen die ultrarechten Arschlöcher so viel besser mit ihren Botschaften durch als alle anderen?
Das Phänomen ist immer dasselbe: Egal, ob Trump, AfD oder Kickl – sie dominieren Diskurs und Medien, die liberalen Stimmen kommen dagegen nicht an. Warum?
Diese Fragen werden mir gestellt, ich bin ja schließlich der „Medienexperte und Kommunikationsberater“. Mittlerweile kann ich meine Antwort halbwegs strukturiert und kompakt formulieren:
1. Einfache Botschaft
Wer für komplexe Probleme einfache Lösungen anbietet, liegt nicht richtig – ist aber kommunikationstechnisch im Vorteil.
Der Mensch hat im Laufe der Evolution gelernt, den Energiefresser Gehirn nicht dauernd einzuschalten. Einfache Botschaften kommen diesem Instinkt entgegen, indem sie sofort erkennbar sind und keinen Denkprozess erfordern. Sie entlasten uns physisch und sind daher willkommen.
Darüber hinaus haben einfache Botschaften eine integrative Wirkung: Menschen mit Bildungs- und Aufmerksamkeitsdefiziten (und letzteres ist heute ein Massenphänomen) verstehen sie und fühlen sich abgeholt – nicht unbedingt durch den Inhalt, alleine durch die Möglichkeit zu folgen.
2. Einfache Gefühle
Gruppenzugehörigkeit und Feindbilder sind tief in unserem Steinzeitgehirn verankerte Muster. Rechte definieren immer „Wir“ gegen „die anderen“. Diese Polarisierung aktiviert jede Amygdala.
Dazu kommt ein weiterer emotionaler Hebel: Verlust wird bewiesenermaßen als stärkeres Gefühl wahrgenommen als ein möglicher Gewinn. Konservative, die sich per definitionem für das Bewahren einsetzen und mit Verlustängsten spielen, sind immer im Vorteil gegenüber Progressiven, die eine Zukunftsvision verkaufen möchten.
Ein „Eindringling“ ist fühlbar, „Klimaziele“ nicht.
3. Einfach Wurscht
Ein salopper Umgang mit Fakten und Regeln des zivilisierten Diskurses bringt jeden Kommunikator in eine offensiv-befreite Position. Wer sich nicht um Fakten schert, kommt auch nie in Argumentationsnot. Postfaktische Botschaften sind schnell für jedes politische Ziel gefunden.
Wer hingegen mit Fakten argumentiert, muss recherchieren, nachdenken, überprüfen. Ein solcher Kommunikator verliert im Diskurs an Tempo und hat schnell den Anschein, in der Defensive zu sein.
Die dann präsentierten Fakten zum Untermauern der eigenen Argumentation können sogar eine negative Wirkung auf den Standpunkt haben: Wenn nämlich die Kernbotschaft dadurch verkompliziert (und in der Wahrnehmung verwässert) wird oder wenn sie für Teile des Publikums nicht leicht verständlich sind. Diese Teile fühlen sich dann wieder ausgeschlossen.
4. Social Media
Der moderne Medienkonsum ist scrollen, nicht schmökern. Wer es nicht schafft, dass sich der Adressat in Sekundenbruchteilen angesprochen fühlt, hat verloren. Auch hier sind naturgemäß einfache Botschaften im Vorteil.
Ob es daran liegt, dass „die Rechten“ sehr schnell verstanden haben, wie gut Social Media zu ihrer Vereinfachung und Emotionalisierung passt oder ob’s an einem intellektuellen Snobismus der Liberalen liegt, sich mit sowas Banalem wie Social Media nicht rechtzeitig auseinander zu setzen – die Rechten bespielen jedenfalls die Klaviatur von Facebook & Co. traditionell geschickter.
5. Überforderte Medien
Ein US-Präsident Trump ist – auch – Ergebnis eines verheerenden Medienversagens.
Fehler Nummer eins: Jede Idiotie wird apportiert. „They are eating the cats, they are eating the dogs…“ hatte eine Media-Coverage, die sich jeder Klimaforscher wünschen würde.
Was Haider in Österreich schon in den Neunzigern testete, ist bei Trump ein eingespielter Mechanismus: Absurditäten rauszuhauen, um den News-Cycle zu dominieren und den politischen Gegnern gar keinen medialen Platz zu lassen. Je nach Bedarf dann zurückrudern oder nicht, bis – zur nächsten Absurdität.
Argumente seitens der Medien: Die Verantwortung, darüber zu berichten, und der kommerzielle Druck. Ok, geschenkt. Wenn man berichtet, dann mit Einordnung. Und hier folgt Fehler Nummer zwei: Medien versuchen, mit gewöhnlichem Handwerk außergewöhnlichen Phänomenen zu begegnen. Das kann nicht funktionieren.
Natürlich sind eingespielte Routinen einfacher und sicherer – aber man kann nicht weiterhin brav mit den Bauern Einzelfelder vorrücken, wenn die Taube längst aufs Schachbrett geschissen hat.
Der Effekt dieses Festhalten an bewährten Textbausteinen ist nämlich eine Normalisierung („Sanewashing“) des Absurden: Trumps Gestammel, in Kanada einzufallen, ist kein „polarisierender Plan“; die Shitshow im Oval Office gegenüber Selenskyj war keine „Eskalation“ oder „Streit“ (die sind beidseitig); Trumps erratisches Um-sich-Schlagen ist nicht mit „Umstrittene Zollstrategie“ treffend getitelt…


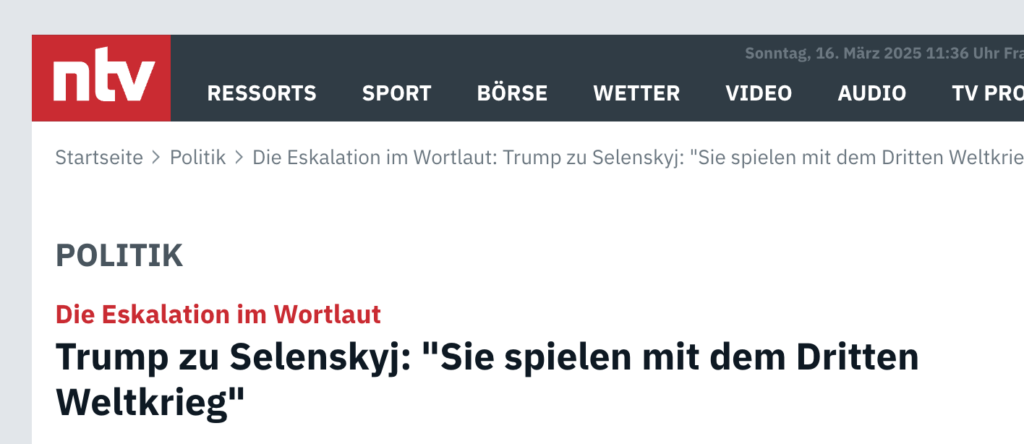
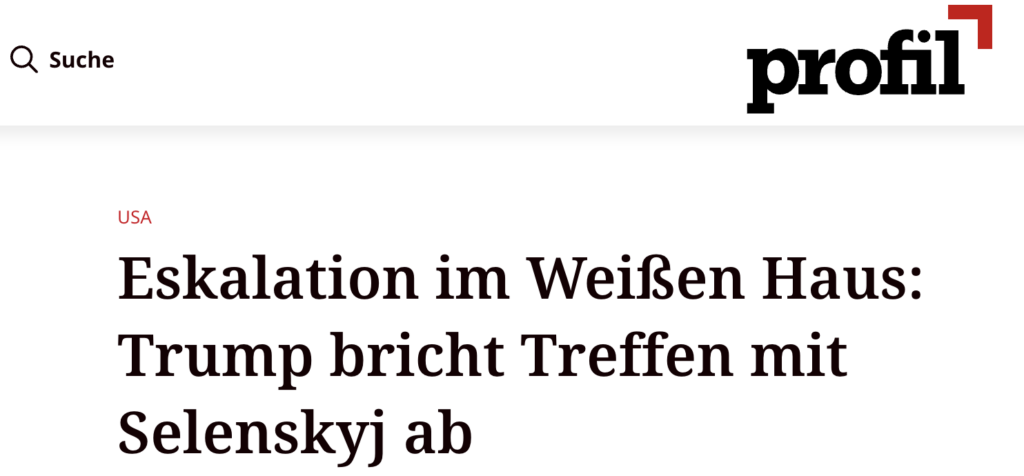
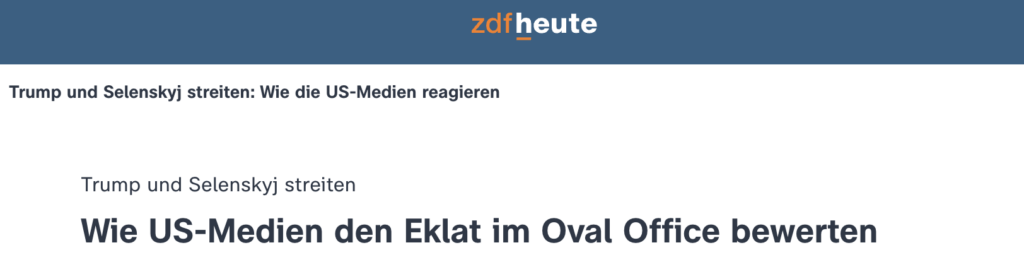
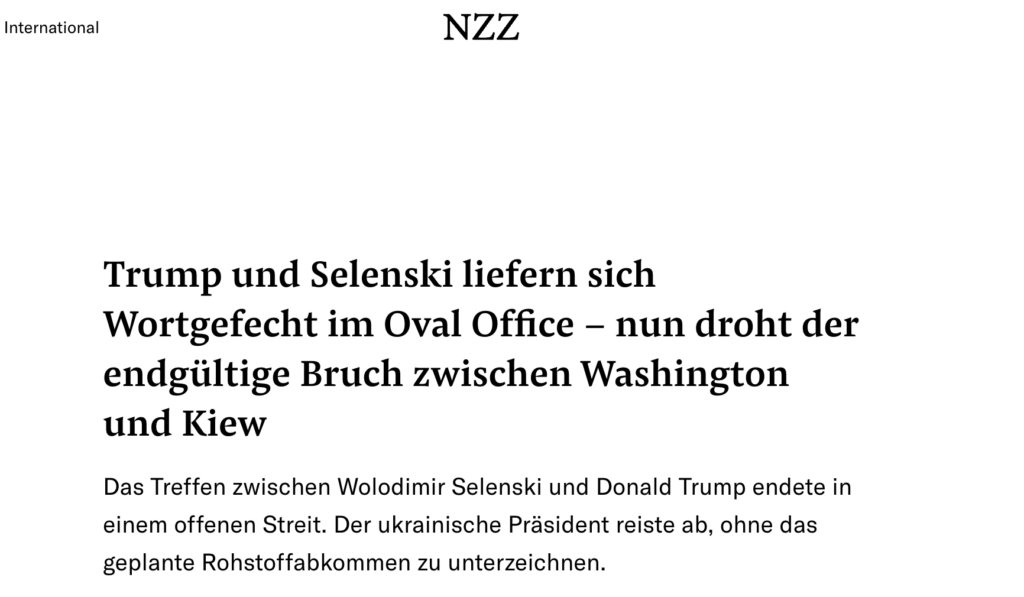
Mehr zum Thema Bothsideism in meinem nächsten Bllogpost
Solange die Medien an ihrer journalistischen Folklore festhalten, glaubt das Publikum: „Alles im grünen Bereich, dieser Politiker ist eventuell etwas exzentrisch.“
Normale Sprache vermittelt Normalität. So wird ein mögliches Ende der Demokratie verpennt. (Das Gleiche gilt übrigens für die Klimakrise.)
6. Überforderte Gegner
Ähnlicher Mechanismus: Viele versuchen einen politischen argumentativen Diskurs mit Gegenspielern, die diesen längst verlassen haben.
Dabei wird immer und immer wieder der Fehler gemacht, auf den vereinfachten rechten Frame einzusteigen. Durch die wörtliche Wiederholung wird – auch bei gegenteiliger Argumentation – der ursprüngliche Frame gepusht, das rechte Narrativ gestärkt.
Was draußen ankommt: Wenn alle Politiker von „Irregulärer Migration“ sprechen, dann muss es wohl wirklich ein sehr wichtiges Thema sein. Gut, dass FPÖ/AFD… das angesprochen haben! Und durch die Wiederholung des Terminus‘ wird FPÖ/AFD… die Themenführerschaft auf dem Silbertablett serviert.
Das ist alles nicht unbedingt neu, und ich erhebe mit den sechs Punkten natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jedenfalls habe ich versucht, die – aus kommunikationstechnischer Sicht – für mich wichtigsten Punkte im Sinne des oben Gesagten möglichst kompakt zu formulieren.
Der Titel diese Blogposts spielt ganz offensichtlich mit Vereinfachung, Emotionalisierung und „wir“ gegen „sie“.
Hätten Sie den Text auch gelesen, wenn er gelautet hätte: „Sechs Thesen, warum rechter Populismus in der heutigen Medienwelt kommunikationstechnisch im Vorteil ist“?

